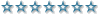Im Rahmen der GKV wird intern ja mannigfaltig unterschieden.
plicht - freiwillig, familienversichert, hauptberuflich vs. nebenberuflich Selbstädnige, und einige andere mehr.
Je nachdem als was man eingestuft wurde gibt es diverse Unterschiede in der Beitragszahlung:
Basis nur der Arbeitslohn, Basis alle Einkünfte, Diverse Mindesteinkommenssätze als Basis, ...
Was war denn nun die Intention des Gesetzgebers hinter all diesen Unterscheidungen?
Warum zahlen die einen mehr und die anderen weniger?
Gibt es in diesem Getümmel eine erkennbare Logik?
Logik der GVK-internen "Klassenunterschiede" pfl.-
Moderatoren: Rossi, Czauderna, Frank
-
sunflower7
- Postrank1

- Beiträge: 5
- Registriert: 27.11.2014, 12:44
Das System der GKV ist historisch gewachsen, nachhaltige Logik darf man nicht erwarten.
-Basis nur Arbeitslohn: Historisch galten zunächst die abhängig Beschäftigten als schutzbedürftig. Weitere Einkünfte waren in der Regel nicht vorhanden.
Das stimmt heute so pauschal im Zeitalter der Erbengeneration mit teilweise hohen Vermögenswerten und entsprechenden Erträgen nicht mehr. M.E. ist zwischenzeitlich der eigentliche Grund die Beschränkung auf Lohneinkünfte die Verwaltungsvereinfachung. Für 40 Millionen Beschäftigte alle Einkünfte zu prüfen wäre ein Riesenaufwand, jedenfalls solange dies nicht automatisiert geschieht. Das gilt analog für das Millionenheer der pflichtversicherten Rentner.
Von einer automatisierten Erfassung aller Einkünfte sind wir allerdings nicht mehr weit entfernt ("gläserner Bürger").
-Selbständige: (widerlegbares) Argument für höhere Mindestbemessung: Zur Beitragsbemessung des Arbeitnehmers wird dessen Bruttoeinkommen (also ohne Abzug von Werbungskosten) herangezogen. Bei Selbständigen hingegen wird der Gewinn -nach Abzug von Betriebsausgaben- verbeitragt
-Basis nur Arbeitslohn: Historisch galten zunächst die abhängig Beschäftigten als schutzbedürftig. Weitere Einkünfte waren in der Regel nicht vorhanden.
Das stimmt heute so pauschal im Zeitalter der Erbengeneration mit teilweise hohen Vermögenswerten und entsprechenden Erträgen nicht mehr. M.E. ist zwischenzeitlich der eigentliche Grund die Beschränkung auf Lohneinkünfte die Verwaltungsvereinfachung. Für 40 Millionen Beschäftigte alle Einkünfte zu prüfen wäre ein Riesenaufwand, jedenfalls solange dies nicht automatisiert geschieht. Das gilt analog für das Millionenheer der pflichtversicherten Rentner.
Von einer automatisierten Erfassung aller Einkünfte sind wir allerdings nicht mehr weit entfernt ("gläserner Bürger").
-Selbständige: (widerlegbares) Argument für höhere Mindestbemessung: Zur Beitragsbemessung des Arbeitnehmers wird dessen Bruttoeinkommen (also ohne Abzug von Werbungskosten) herangezogen. Bei Selbständigen hingegen wird der Gewinn -nach Abzug von Betriebsausgaben- verbeitragt
-
sunflower7
- Postrank1

- Beiträge: 5
- Registriert: 27.11.2014, 12:44
Das mit der Verwaltungsvereinfachung ist sicher ein Argument, aber bei der Kirchensteuer funktioniert es ja schließlich auch.
Ich habe da noch was gefunden:
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - L 16 KR 352/10 - Urteil vom 09.12.2010
http://www.anhaltspunkte.de/rspr/urteil ... 352.10.htm
Jetzt fehlt nur noch jemand der mir die Entscheidungsgründe "ausdeutscht", vereinfacht darlegt und zusammenfasst.
Hier mal der vermutlich wichtigste Abschnitt:
Ich habe da noch was gefunden:
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - L 16 KR 352/10 - Urteil vom 09.12.2010
http://www.anhaltspunkte.de/rspr/urteil ... 352.10.htm
Jetzt fehlt nur noch jemand der mir die Entscheidungsgründe "ausdeutscht", vereinfacht darlegt und zusammenfasst.
Hier mal der vermutlich wichtigste Abschnitt:
- Eine ungleiche Behandlung mehrerer Gruppen von Normadressaten ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, wenn zwischen ihnen Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen können und wenn zudem ungleiche Behandlung und rechtfertigender Grund in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Bereits mit Urteil vom 24.11.1992 (B 12 KR 8/92) und seither in ständiger Rechtsprechung (zuletzt mit Urteil vom 17.03.2010 - B 12 KR 4/09 R -) wird vom BSG ausgeführt, die Zugehörigkeit von Versicherten zum jeweiligen System der Pflichtversicherten bzw. der freiwilligen Mitglieder sei von solchem Gewicht, dass sie die unterschiedliche Behandlung der Beitragsbemessung rechtfertige. Dem Gesetzgeber stehe ein Gestaltungsspielraum bei der Frage zu, welche das jeweilige Versicherungsverhältnis typischer Weise prägende Einnahmeart der Beitragspflicht unterworfen werden solle. Dabei dürften Gesichtspunkte der sozialen Schutzbedürftigkeit und der Beitragsäquivalenz ebenso berücksichtigt werden wie Erfordernisse einer Massenverwaltung. Regelungen, wonach sich die Beitragshöhe bei versicherungspflichtig Beschäftigten allein aus ihrem Arbeitsentgelt ergebe und bei freiwillig Versicherten die Beitragsbemessung grundsätzlich an der gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auszurichten sei, lägen deshalb im Rahmen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. Daran ist auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Klägerin festzuhalten.
Entscheidend ist entgegen der Auffassung der Klägerin nicht, ob die Anzahl der gut verdienenden pflichtversicherten Arbeitnehmer angestiegen ist und gleichzeitig mehr freiwillig versicherte Selbständige nur noch Einkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze erzielen. Denn die Einkommensverhältnisse der genannten Personengruppen sind nicht das eine Ungleichbehandlung rechtfertigende Kriterium. Es bestand deshalb auch keine Veranlassung, den Beweisanträgen der Klägerin nachzugehen. Entscheidend ist vor allem darauf abzustellen, dass unabhängig von der jeweiligen Einkommenshöhe der Gewinn aus selbständiger Tätigkeit hinsichtlich der Methoden der Ermittlung und der Gestaltungsmöglichkeiten des Empfängers in keiner Weise mit dem Arbeitseinkommen aus abhängiger Beschäftigung vergleichbar ist. Werbungskosten können von Arbeitnehmern beispielsweise nur vom zu versteuernden Einkommen, nicht aber von den beitragspflichtigen Einnahmen abgesetzt werden, während der Gewinn eines Selbständigen sich aus den um sämtliche Ausgaben verminderten Einnahmen ergibt. Darüber hinaus stehen Selbständigen im Unterschied zu Arbeitnehmern vielfältige tatsächliche oder steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten mit Einflüssen auf die Höhe ihrer Einkünfte und damit den beitragspflichtigen Einnahmen offen. Ein Selbständiger hat beispielsweise die Möglichkeit, einen Betriebsgewinn nicht zu entnehmen, sondern in Betriebsvermögen umzuwandeln. Wird dieses Betriebsvermögen dann aufgelöst, wenn die Einkünfte ohnehin die Beitragsbemessungsgrenze überschreiten oder wenn der Selbständige vorher in die private Krankenversicherung wechselt, hat er darauf keine Beiträge entrichten müssen.
Hallo,
Amtsdeutsch in Umgangssprache zu übersetzen - gelingt nicht immer und bedarf auch, gerade bei solchen Urteilen viel Zeitaufwand, dafür gibt es eben Rechtsanwälte, und in diesem Falle war die Klägerin selbst Rechtsanwältin, die ihren Mandanten das so erklären was im Urteil drinnen steht, dass diese es auch verstehen. Was hast du denn nicht verstanden und was kann ich mit deinem Begriff "ausdeutscht" anfangen ?
Einfach und schlicht gesagt, hat das Urteil bestätigt, dass freiwillig Versicherte eben auch für andere Einkunftsarten Beiträge zahlen müssen und Pflichtversicherte eben nicht.
Gruss
Czauderna
Amtsdeutsch in Umgangssprache zu übersetzen - gelingt nicht immer und bedarf auch, gerade bei solchen Urteilen viel Zeitaufwand, dafür gibt es eben Rechtsanwälte, und in diesem Falle war die Klägerin selbst Rechtsanwältin, die ihren Mandanten das so erklären was im Urteil drinnen steht, dass diese es auch verstehen. Was hast du denn nicht verstanden und was kann ich mit deinem Begriff "ausdeutscht" anfangen ?
Einfach und schlicht gesagt, hat das Urteil bestätigt, dass freiwillig Versicherte eben auch für andere Einkunftsarten Beiträge zahlen müssen und Pflichtversicherte eben nicht.
Gruss
Czauderna
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste