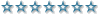ich habe folgendes Problem/Frage.
Meine Frau ist derzeit bei mir mit versichert gem. § 10 Abs. 5 SGB V, da sie einen Minijob hat und nur 390€ verdient, gilt sie als geringfügig Beschäftigt gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV. Zusätzlich würden ihr jedoch nun in Zukunft noch Mieteinnahmen anteilig zufließen.
Ich habe nun gelesen, dass ihr Gesamteinkommen ja nur 400€ / Monat sein darf, da sie geringfügig Beschäftigt ist - § 10 Abs. 5 SGB V, dementsprechend ergibt sich ein Höchstbetrag des Gesamteinkommens von 12 x 400€ = 4.800€ für das Jahr.
Das Gesamteinkommen bezieht sich gem. §16 SGB IV auf die Summe der Einkünfte des Einkommensteuerrechts, das wäre dann geregelt in § 2 Abs.1 + 2 EStG.
Nun zu meinen Fragen:
1. Laut EStG sind Einkünfte = Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten. - § 2 Nr. 2.
Das würde doch bedeuten, dass ich auch die Werbungskostenpauschale i.H.v. 920€ (§9a EStG) abziehen kann von den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit oder nicht? Habe jetzt schon häufiger gelesen, dass es nicht geht, bei „Wikipedia“ wiederum steht, dass ich es machen kann bei der Berechnung für die Familienversicherung. Was ist nun richtig? Oder darf ich bei der Berechnung für die Krankenversicherung nicht die Pauschale verwenden, sondern nur tatsächliche Werbungskosten?
In der Einkommensteuererklärung gebe ich den Minijob bzw. den Bruttoarbeitslohn (390€ / Monat) ja gar nicht an, weil pauschale Lohnsteuer abgeführt wird vgl. § 40 Abs. 3 EStG. Er ist aber demnach dennoch Arbeitslohn und wäre somit Einnahme aus nichtselbständiger Arbeit, d.h. doch dann auch, dass mir ein Werbungskostenabzug auch zusteht.
Im Einkommensteuerrecht würde ich die Wk-Pauschale (920€) ja nur nicht erhalten, weil durch die pauschale LSt einkommensteuerrechtlich alles abgegolten ist und der Arbeitslohn des Minijobs außer Ansatz bleibt (§ 40 Abs. 3 EStG). Wenn ich den Minijob bzw. den Arbeitslohn aber als Einnahme aus nichtselbständiger Arbeit bei der Berechnung für die Familienversicherung mit einbeziehen soll/muss und sie sich auf das Einkommensteuerrecht beziehen, dann steht mir doch auch die Werbungskostenpauschale zu bzw. dürfte ich auch Werbungskosten davon abziehen oder nicht? So ist zumindest mein Rechtsverständnis :-/
Gibt es denn da schon Urteile die sich damit auseinandergesetzt haben bzw. Gesetzesstellen, die ich übersehen habe oder steht es fest, dass ich die WK-Pauschale abziehen darf?
Habe gerade folgenden Text gefunden in einer Broschüre, leider ohne Gesetzesangaben:
„Bei pauschal besteuertem Arbeitslohn (z. B. nach § 40a EStG für bestimmte Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte möglich) können Werbungskosten nicht abgesetzt werden, weil der Arbeitgeber in diesen Fällen Schuldner der pauschalen Lohnsteuer ist und der pauschal besteuerte Arbeitslohn und die pauschale Lohnsteuer bei einer Veranlagung zur Einkommenssteuer und beim Lohnsteuerjahresausgleich außer Ansatz bleiben.“
Soweit so gut….aber eigentlich ist das doch absolut ungerecht wenn das so ist. Denn der Werbungskosten Abzug in der Einkommensteuererklärung wird einem ja nur versagt, weil der Arbeitslohn aus einem Minijob auch nicht angegeben wird bei der Einkommensteuerberechnung, da durch die pauschale LSt. Für die Berechnung des Gesamteinkommens für die Familienversicherung muss aber doch der Arbeitslohn aus dem Minijob angegeben werden und wenn er bei der Familienversicherung mit berechnet wird, dann müsste man doch auch Werbungskosten abziehen dürfen :-/
Meiner Meinung nach ist der Verweis auf das EStG im Bezug auf den Minijob ungerecht, wenn man im Gegensatz zur Einkommensteuer bei der Familienversicherung auf einmal die Einnahmen aus dem Minijob mit einberechnet. Denn wenn man §40a auf die KV bzw. Familienversicherung überträgt, so wird der Minijob Einkommensteuerrechtlich in der Einkommensteuer nicht mit angegeben, da schon pauschale LSt gezahlt wurde, dementsprechend bräuchte man ihn dann ja bei der Berechung des Gesamteinkommens bei der Familienversicherung auch nicht mit einbeziehen, da ja schon ein pauschaler Beitrag zur KV gezahlt wird vom AG.
2. Wenn das Gesamteinkommen nur 400€ pro Monat betragen darf und sie schon 390€ pro Monat verdient (falls man doch WK abziehen kann, dann würde sich das dementsprechend verringern), dann dürfte sie doch nur 10€ pro Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung haben um noch familienversichert zu sein oder? D.h. Mieteinnahmen – Werbungskosten (AfA Gebäude, Erhaltungsaufwendungen ect.) = 10€ Überschuss pro Monat = 120€ im Jahr. Das wäre ja nicht gerade viel :-/ Könnte sie dann nicht auf Gehalt verzichten (z.b. 60€), so dass sie nur 330€ verdient pro Monat (d.h. 3.960€ im Jahr) und dann könnten ihre anteiligen Einkünfte aus V+V ja z.B. 70€ pro Monat sein (d.h. 840€ im Jahr und somit wäre man insgesamt bei 3.960 + 840 = 4.800 und das wäre dann ja auch der Höchstbetrag pro Jahr gem. § 10 Abs. 5 SGB V). Ein Verzicht von 60€ Lohn / Monat wäre dann ja immer noch günstiger als freiwilliges Mitglied einer KV mit ca. 130€ / Monat.
Ich hoffe ihr könnt mir mit diesem Problem weiter helfen. Das Schreiben des Textes hat sicherlich länger gedauert, als die Beantwortung